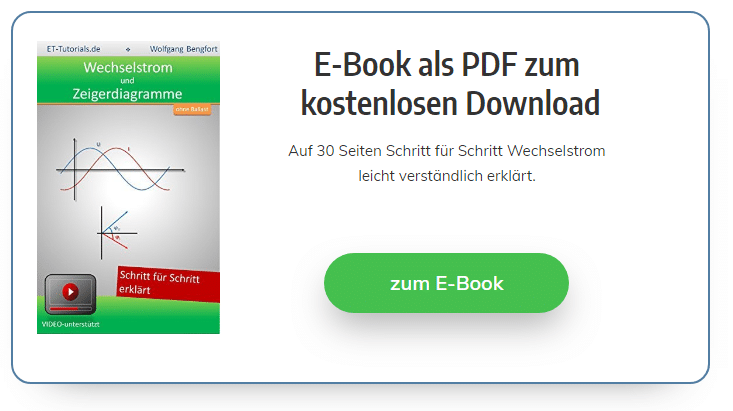Nach der Auswahl eines geeigneten Leiterquerschnittes folgt die Prüfung des Spannungsabfalls (in den VDE-Normen als „Spannungsfall“ bezeichnet) auf der Leitung. Fällt auf der Leitung eine zu große Spannung ab, dann ist die Spannung am Verbraucher zu gering. Das kann zwei unterschiedliche Folgen haben:
- Der Verbraucher arbeitet mit einer kleineren Spannung, demzufolge stellt sich ein kleinerer Strom ein und die Leistungsaufnahme sinkt. Beispiel: Wärmegerät
- Der Verbraucher hält die aufgenommene Leistung konstant. Bei kleiner werdender Spannung muss der Strom größer werden. Der Betriebsstrom Ib steigt an. Beispiel: Elektromotor
Der Spannungsfall wird mit ΔU bezeichnet. Das Δ symbolisiert, dass der Spannungsfall dem Unterschied zwischen der Quellenspannung und der Verbraucherspannung entspricht.
Spannungsfall berechnen
Der Spannungsfall auf der Leitung ist abhängig vom Leiterwiderstand RL und dieser wiederum vom Leitermaterial (spezifischer Leitwert κ), Leiterquerschnitt q und der Leitungslänge l abhängig ist:
RL=l/(κ*q)
Der Widerstand der Anschlussleitung liegt in Reihe zum Verbraucher. Es ergibt sich also eine Reihenschaltung aus dem Leitungswiderstand der Hinleitung, dem Verbraucher und dem Leitungswiderstand der Rückleitung. In einer Reihenschaltung ist der Strom I an allen Widerständen gleich groß. Der Spannungsfall an den beiden Leitungswiderstand ergibt sich also zu:
Meine Empfehlung für Elektrotechniker
ΔU= 2*RL*I
Für RL setzt man jetzt die entsprechenden Größen für den Leitungswiderstand von oben ein. Setzt man für den Stromwert den Nennstrom der Sicherung In ein, dann berechnet man den maximalen Spannungsfall (wie hier). In allen anderen Fällen setzt man für I den Betriebsstrom Ib ein:
ΔU= 2*l*In / (κ*q)
Diese Formel gilt jedoch lediglich für Gleichstromkreise. Im Wechselstromkreis wird mit dem Leistungsfaktor cos(φ) eine mögliche Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung berücksichtigt. Dann berechnet sich der Spannungsfall zu:
ΔU= 2*l*In*cos(φ) / (κ*q)
Bei symmetrischen Drehstromverbrauchern heben sich die drei Außenleiterströme gegenseitig auf, sodass kein Rückstrom auftritt und der Spannungsfall nur auf dem Widerstand eines Außenleiters entsteht. Demzufolge fällt der Faktor 2 in der Formel weg. Da der Spannungsfall aber in der Regel auf die Außenleiterspannung (400V) bezogen wird, die um den Faktor √3 größer ist als die Strangspannung (230V), fügt man in der Formel den Faktor √3 hinzu. Damit ergibt sich der Spannungsfall zu:
ΔU= √3*l*In*cos(φ) / (κ*q)
Zusätzliche Anmerkungen zur Spannungsfallberechnung:
- Alle Berechnungen beziehen sich auf eine Leitertemperatur von 25°C. Sollte die Umgebungstemperatur deutlich davon abweichen ist mit einem entsprechend größeren Leitungswiderstand zu rechnen.
- Es wurde vereinfacht angenommen, dass der ohmsche Teil des Leitungswiderstandes überwiegt, was bei Leiterquerschnitten bis 70mm² vertretbar ist.
- Häufig wird der Spannungsfall nicht in Volt, sondern als Prozentwert der Netzspannung U0 angegeben (U0=230V bei Wechselspannung; U0=400V bei Drehstrom). Das Formelzeichen ist ein kleines Δu:
Δu= (ΔU / Δu) * 100%
- In Verbraucheranlagen sollten die Leitungsquerschnitte so gewählt werden, das der Spannungsfall nicht mehr als 3% der Nennspannung beträgt. Kann die Vorgabe nicht erfüllt werden, dann muss der Leitungsquerschnitt um eine Normgröße erhöht werden.
In dem nachfolgenden Video erläutere ich noch einmal Schritt für Schritt die Berechnung des Spannungsfalls an einem Beispiel: